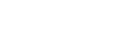für ein schneeweißes andorra
Frankfurter Rundschau vom 23. April 2015
Beklemmend wie am ersten Tag: Max Frischs Klassiker „Andorra“ in den
Landungsbrücken in Frankfurt, mit Schülerinnen und Schülern des „theater et
zetera“. Ein Lehrstück für Publikum und Akteure.
Woher wisst ihr eigentlich alle, wie der Jud’ ist?“ Neben den vielen Fragen, die Max
Frisch mit seinem Drama „Andorra“ aufwirft, ist diese sicherlich eine der drängendsten.
Andri, der Protagonist, wirft sie seinen Mitmenschen an den Kopf, schleudert ihnen
damit seine vermeintliche Identität entgegen, an der er so entschieden festhält, dass es
ihn am Ende das Leben kostet. Das Stück, uraufgeführt 1961 im Schauspielhaus Zürich,
prägte wie kaum ein anderes den Umgang mit der Judenverfolgung in der
Nachkriegszeit. Bei der Aufführung des „theater et zetera“ wird deutlich, wie wenig wir
uns von den Schrecken, die Frisch in den sechziger Jahren malte, entfernt haben.
Die Schauspieler, allesamt zwischen 12 und 16 Jahre alt, winden sich, grämen sich,
bespucken sich, und vor allem misstrauen sie sich. Auf der Bühne in den
Landungsbrücken im „wilden Frankfurter Westen“, wie die Gründer es nennen, wird klar:
Das, was Vorurteile, Ängste und Unwissen mit den Menschen machen, ist heute nicht
anders als in den Jahren, in denen der Judenhass in Deutschland und Europa so groß
war wie nie.
Er kann es nicht mehr hören
„Ich kann es nicht mehr hören, überall höre ich nur Jud’, Jud’, Jud’!“, schimpft der Lehrer
Can, der Vater des angeblichen Juden Andri – der ist eigentlich sein uneheliches Kind,
und er gab nur vor, er sei ein jüdisches Findelkind, dessen er sich angenommen habe.
Can ist entsetzt über die Ignoranz seiner Landsleute und deren diffuse Angst vor dem
Fremden, dem Feind und am Ende auch dem Freund.
Die Aufführung ist ein Lehrstück für das Publikum und dient sicher auch der Bildung
der Schülerinnen und Schüler, die im Begleitheft darstellen, wie schwer manchmal die
Identifikation mit den Rollen fiel. Da ist der verachtende und verachtenswerte Soldat
Peider oder der steife und unbelehrbare Tischlermeister Prader, die, in ihren Urteilen
über das Menschliche unabrückbar gefangen, auch am Ende, als alles zu spät ist, nicht
zweifeln.
„Ich, ich habe nicht gewusst...“ – dieser Satz hallt wieder und immer wieder durch den
kleinen Saal, wenn die Andorraner zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Untermalt
von einem seltsamen Brummen, das klingt wie eine Störung des Mikrofons, gräbt sich
diese Kakophonie in die Ohren der Zuschauer, doch auf der Bühne scheint niemand sie
zu hören. Und so trifft auch niemanden die Schuld, denn die ist kollektiv und ein jeder
kann sich in der Masse verstecken.
Von Elena Müller
nehmen Sie kontakt mit uns auf
Tel: 01733090939
E-Mail: theater-etzetera@t-online.de
Web: www.theater-etzetera.de
Adresse: Rhönstraße 4a
61381 Friedrichsdorf
andorra


darsteller*innen
Adrien Einecke Amelie Karl Benjamin Förtsch Bersun Boztepe Carla Volk David Ziegler Fee Forberich Felix Simon Jan Gottwald Joshua Alberti Joshua Ruddock Lara Tillner Lea Segieth Lena Felberbauer Leonard Gürtler Sofia Janßen Ortiz Sven Göbel Gesa Brieskornpremiere
Landungsbrücken Frankfurt 21. April 2015
aufführungsdaten

projekt
Eine Kooperation zwischen theater et zetera und der Jugend-Kultur-Werkstatt Falkenheim Gallus e.V.

Andri, ein junger Mann, wird von seinem Vater
unehelich mit einer Ausländerin gezeugt und von
diesem als jüdischer Pflegesohn ausgegeben.
Die Bewohner Andorras begegnen Andri permanent mit Vorurteilen, so dass er, selbst nachdem er
seine wahre Herkunft erfahren hat, an der ihm zugewiesenen jüdischen Identität festhält. Es folgt seine
Ermordung durch ein rassistisches Nachbarvolk. Nachdem die Andorraner alles geschehen ließen,
rechtfertigen sie ihr Fehlverhalten und ihre Feigheit vor dem Publikum und leugnen ihre Schuld.
Das Ensemble präsentiert “Andorra” als ein soziologisches Modell, von Theaterfiguren durchgespielt,
als eine Versuchsanordnung zwischen Menschengruppen, die ihre eigenen Probleme nur durch
Projektionen bewältigen können.
Die Figuren aus „Andorra“ verdeutlichen mit welcher Zwangsläufigkeit bestimmte soziale
Bedingungen – Orte, an denen wir alle leben – kollektive Vorurteile und entsprechende
Gewalthandlungen hervorbringen können, und welche Bedürfnisse, Empfindungen und Phantasien
auch die Jugendlichen dafür anfällig machen (können).
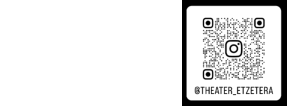
szene
andorra
ERNST-LUDWIG-SCHULE:
130 SCHÜLER DER ELS REISEN NACH “ANDORRA”
Andorra ist auf Sand gebaut. Zumindest ist die Bühne in der großen Halle der Landungsbrücken am Westhafen
Frankfurts, auf der uns eine Vorstellung von Max Frischs bekanntem Stück erwartete, von einer dicken Sandschicht
bedeckt. Man könnte hier sofort an eine Beach Party denken, aber schon der Weg durch die düsteren Gänge des
ehemaligen Lagergebäudes in den schummrig beleuchteten Saal stimmte uns darauf ein, dass uns etwas weitaus
Bedrückenderes erwarten würde.
Der Sand bildet den mürben Grund für Lügen, Selbstbetrug und
tödliche Vorurteile, aus denen Andorra erbaut ist. Gleich zu Beginn der
Vorführung führt uns ein Chor mit blutrot und weiß verzerrten
Clownsfratzen vor Augen, dass dieses Andorra ein (Sandkasten?) -
Modell unser aller Abgründe ist. Andorra findet sich überall und bleibt,
auch wenn es bereits 1961 zum ersten Mal in Zürich aufgeführt wurde,
immer aktuell. Wer denkt dieser Tage nicht sofort an die Vorbehalte
gegen „die Fremden“, die bei seltsam anmutenden Demonstrationen
von PEGIDA-Anhängern verlautbart werden?
Das Jugendensemble theater et zetera, das unter der Leitung von
Georg Bachmann dieses Stück innerhalb von nur neun
Wochenendworkshops inszeniert hat, setzt diese Modellhaftigkeit
konsequent um: So kommen zum Beispiel die jungen Schauspieler im Freizeit-Outfit auf die Bühne und kletten sich
erst dort die Kostüme vor die Brust. Auch schaffen die skurrilen Lügennasen, die alle Andorraner tragen – außer ihrem
Opfer Andri – kritische Distanz. Diese Nasen sind, wie uns das Ensemble später bei der Nachbesprechung verriet, eine
verfremdende Umkehrung der grotesken Rassenvorurteile gegen Juden, die von den nationalsozialistischen
Eugenikern verbreitet wurden. Hier sind es nun die Andorraner, die das Stigma tragen, nicht der Junge, den sie zum„
Jud“ machen. Erst wenn er ihr Vorurteil annimmt, wird er auch äußerlich einer von ihnen. Andri mit Nase, nachdem er
sein “Judsein” angenomme hat.
Diese gewagten Stilmittel machten uns Zuschauer auf das bevorstehende Schauspiel neugierig. Mit etwa 130
Schülerinnen und Schülern aus der E-Phase und einer neunten Klasse fuhren wir in drei Bussen am 23. April zu einer
Sondervorstellung nur für die Ernst-Ludwig-Schule nach Frankfurt
zu den Landungsbrücken. Der Ausflug ist Teil des TuSch-Projekts,
an dem die ELS seit drei Jahren teilnimmt. TuSch heißt Theater und
Schule und ist eine Kooperation, die eben nicht nur Theater in die
Schule, sondern, so wie bei dieser Gelegenheit, eben auch die
Schule ins Theater bringt. Georg Bachmann, der Leiter dieser
Inszenierung von theater et zetera ist im Rahmen von TuSch auch
an der ELS tätig, wo er bereits einen Maskenworkshop leitete,
Kurse im Darstellenden Spiel professionell unterstützte, an der
Erarbeitung einer Szenischen Interpretation von „Andorra“ im
Deutschunterricht mitarbeitete und in einer Theater AG zur Zeit
mitten dabei ist. Vielleicht hat diese Arbeit ja einen Anreiz gegeben,
sich nun mit einer vollständigen Inszenierung Andorras zu beschäftigen.
Hier schließt sich der Kreis, denn viele der Zuschauer der heutigen
Vorführung haben letztes Schuljahr bei der szenischen Arbeit an
Andorra in der Schule mitgewirkt und sind somit nun „Experten“. Es sind aber mit Lea Segith (9c) und Juliane Bernhard
(E-Phase) auch aktuell zwei Schülerinnen der ELS an der Produktion in den Landungsbrücken beteiligt.
Das Ensemble besteht, in variierender Besetzung sonst
vorwiegend aus Frankfurter Schülerinnen und Schülern im
Alter zwischen 12 und 17 Jahren, die teilweise ganz frisch
dabei sind oder schon Erfahrung bei den letzten
Produktionen „Krabat“ und „Peter Pan“ gesammelt haben.
Besonders überzeugend trat der Soldat Peider als
Gegenspieler der Hauptfigur Andri auf, indem er diesen nicht
als tumber Kraftprotz sondern mit hinterhältiger Intelligenz
bedrohte. Erschreckend eindrucksvoll ließ uns Zuschauer
auch der Pater eiskalte Schauer den Rücken herunterlaufen,
wenn er Andri mit langen Fingern zudringlich betastend
dessen Selbstwertgefühl brach. Ebenso frisch wirkte auch die
Interpretation des in Alkoholsumpf und Selbstmitleid
ertrinkenden Lehrer Can, als er bei einem Tangotanz mit dem
Tischler eine Lehrstelle für seinen vermeintlich jüdischen
Pflegesohn Andri herausschlug.
Das Stück kulminierte in der „Judenschau“, die sich durch zischend einströmenden Nebel ankündigte, welcher sehr
unterschiedliche beklemmende Assoziationen bei den Zuschauern auslöste. Den einzigen erholsamen Gegenpol zu
den bedrohlichen Handlungsträgern und Szenen bildete das lebendige Orchestrion (oder Jukebox): Nachdem es die
Münzen, mit denen es von Andri gefüttert worden war, aufgegessen hatte, wiegte es immer wieder genussvoll den
Kopf zu der herzzerreißenden Musik, mit der Andri vergeblich die Bedrängnis in seiner andorranischen Heimat
vergessen machen wollte. Die vielen positiven Rückmeldungen aus den Deutschkursen und Klassen zeigten, dass
das Stück allseits sehr gut angekommen ist und zum Nachdenken provozierte. Vielfach wurde der Wunsch nach
baldiger Weiterführung derartiger Theaterexkursionen geäußert.

Der Chor von Andorra

Die Andorraner ohne Andri

Andri mit Nase, nachdem er sein “Judsein”
angenommen hat
Andri, ein junger Mann,
wird von seinem Vater
unehelich mit einer
Ausländerin gezeugt und
von diesem als jüdischer
Pflegesohn ausgegeben.
Die Bewohner Andorras begegnen Andri
permanent mit Vorurteilen, so dass er,
selbst nachdem er seine wahre Herkunft
erfahren hat, an der ihm zugewiesenen
jüdischen Identität festhält. Es folgt seine
Ermordung durch ein rassistisches
Nachbarvolk. Nachdem die Andorraner
alles geschehen ließen, rechtfertigen sie ihr
Fehlverhalten und ihre Feigheit vor dem
Publikum und leugnen ihre Schuld.
Das Ensemble präsentiert “Andorra” als ein
soziologisches Modell, von Theaterfiguren
durchgespielt, als eine Versuchsanordnung
zwischen Menschengruppen, die ihre
eigenen Probleme nur durch Projektionen
bewältigen können.
Die Figuren aus „Andorra“ verdeutlichen mit
welcher Zwangsläufigkeit bestimmte
soziale Bedingungen – Orte, an denen wir
alle leben – kollektive Vorurteile und
entsprechende Gewalthandlungen
hervorbringen können, und welche
Bedürfnisse, Empfindungen und Phantasien
auch die Jugendlichen dafür anfällig
machen (können).
andorra
frankfurt
20
15









nehmen Sie kontakt mit
uns auf
Tel: 01733090939
E-Mail: theater-etzetera@t-online.de
Web: www.theater-etzetera.de
Adresse: röhnstraße 4a
61381 friedrichsdorf


darsteller*innen
Adrien Einecke Amelie Karl Benjamin Förtsch Bersun Boztepe Carla Volk David Ziegler Fee Forberich Felix Simon Jan Gottwald Joshua Alberti Joshua Ruddock Lara Tillner Lea Segieth Lena Felberbauer Leonard Gürtler Sofia Janßen Ortiz Sven Göbel Gesa Brieskorn
premiere
Landungsbrücken Frankfurt 21. April 2015
aufführungsdaten

projekt
Eine Kooperation zwischen theater et zetera und der Jugend-Kultur-Werkstatt Falkenheim Gallus e.V.für ein schneeweißes andorra
Frankfurter Rundschau vom 23. April 2015 Beklemmend wie am ersten Tag: Max Frischs Klassiker „Andorra“ in den Landungsbrücken in Frankfurt, mit Schülerinnen und Schülern des „theater et zetera“. Ein Lehrstück für Publikum und Akteure. Woher wisst ihr eigentlich alle, wie der Jud’ ist?“ Neben den vielen Fragen, die Max Frisch mit seinem Drama „Andorra“ aufwirft, ist diese sicherlich eine der drängendsten. Andri, der Protagonist, wirft sie seinen Mitmenschen an den Kopf, schleudert ihnen damit seine vermeintliche Identität entgegen, an der er so entschieden festhält, dass es ihn am Ende das Leben kostet. Das Stück, uraufgeführt 1961 im Schauspielhaus Zürich, prägte wie kaum ein anderes den Umgang mit der Judenverfolgung in der Nachkriegszeit. Bei der Aufführung des „theater et zetera“ wird deutlich, wie wenig wir uns von den Schrecken, die Frisch in den sechziger Jahren malte, entfernt haben. Die Schauspieler, allesamt zwischen 12 und 16 Jahre alt, winden sich, grämen sich, bespucken sich, und vor allem misstrauen sie sich. Auf der Bühne in den Landungsbrücken im „wilden Frankfurter Westen“, wie die Gründer es nennen, wird klar: Das, was Vorurteile, Ängste und Unwissen mit den Menschen machen, ist heute nicht anders als in den Jahren, in denen der Judenhass in Deutschland und Europa so groß war wie nie. Er kann es nicht mehr hören „Ich kann es nicht mehr hören, überall höre ich nur Jud’, Jud’, Jud’!“, schimpft der Lehrer Can, der Vater des angeblichen Juden Andri – der ist eigentlich sein uneheliches Kind, und er gab nur vor, er sei ein jüdisches Findelkind, dessen er sich angenommen habe. Can ist entsetzt über die Ignoranz seiner Landsleute und deren diffuse Angst vor dem Fremden, dem Feind und am Ende auch dem Freund. Die Aufführung ist ein Lehrstück für das Publikum und dient sicher auch der Bildung der Schülerinnen und Schüler, die im Begleitheft darstellen, wie schwer manchmal die Identifikation mit den Rollen fiel. Da ist der verachtende und verachtenswerte Soldat Peider oder der steife und unbelehrbare Tischlermeister Prader, die, in ihren Urteilen über das Menschliche unabrückbar gefangen, auch am Ende, als alles zu spät ist, nicht zweifeln. „Ich, ich habe nicht gewusst...“ – dieser Satz hallt wieder und immer wieder durch den kleinen Saal, wenn die Andorraner zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Untermalt von einem seltsamen Brummen, das klingt wie eine Störung des Mikrofons, gräbt sich diese Kakophonie in die Ohren der Zuschauer, doch auf der Bühne scheint niemand sie zu hören. Und so trifft auch niemanden die Schuld, denn die ist kollektiv und ein jeder kann sich in der Masse verstecken.
szene
andorra